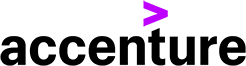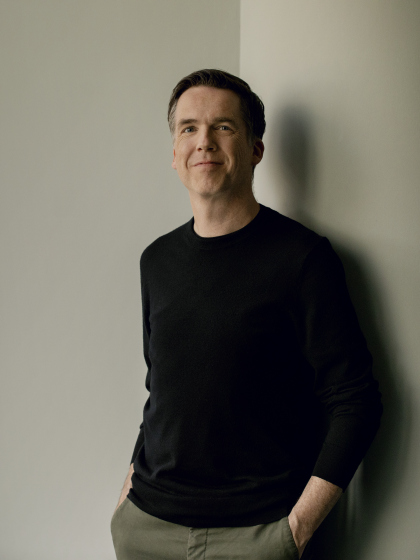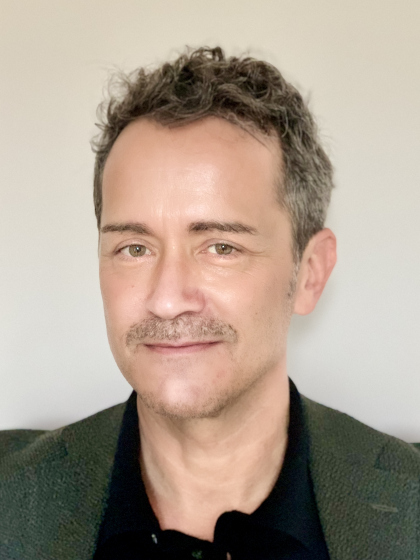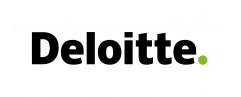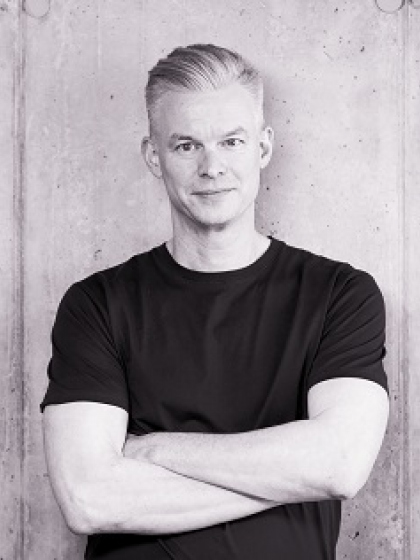Programm
Best-Practice-Dialog I. B3
Digital trifft User: Transformation, die ankommt
Setzen Sie mit Adoption, Change Agents, Personas und der Orange Veränderung erfolgreich um.
Tauchen Sie ein in die spannende Welt der digitalen Verwaltung in Niedersachsen! eAkte und eVorgangsbearbeitung sind Grundpfeiler des Handlungsplans zur Transformation von papiergebundenen zu elektronischen Verwaltungsprozessen. In unserem Vortrag stellen wir Ihnen das Schulungskonzept vor, das die Einführung der eAkte für 24.000 Mitarbeiter in der Landesverwaltung Niedersachsen flankiert. Wir zeigen Ihnen, wie ein ganzheitlicher Ansatz aus projektübergreifendem Change Management, Akzeptanzmanagement, Training und Vor-Ort-Unterstützung Hand in Hand geht. Erfahren Sie, wie Change Agents und Floorwalker den Erfolg im Dreiklang von Projekt, Führungskräften und Mitarbeitenden sichern. Und schließlich entdecken Sie die Möglichkeiten von Digital Adoption mit der "Orange", die nicht nur bei der Nutzung der eAkte im Arbeitsalltag Hilfe bietet, sondern auch darüber hinaus neue Chancen eröffnet. Begleiten Sie uns und lassen Sie sich inspirieren!
Best-Practice-Dialog I. B4
Die Standardisierungsagenda des IT-Planungsrats - oder wie wir Struktur und Transparenz in die föderale Standardisierungswelt bringen wollen
Die Standardisierungsagenda strukturiert die föderalen IT-Standards nach dem Lebenszyklus-Ansatz neu und hilft bei deren effizienter Steuerung.
In diesem Best-Practice-Dialog wollen wir besprechen, welchen Einflussgrößen die Standardisierungsagenda dabei ausgesetzt ist und welche Bedarfe Sie als Nutzende sehen.
Die FITKO vermittelt Ihnen einen Überblick über das Zusammenwirken der Standardisierungsagenda mit weiteren Disziplinen des IT-Planungsrats: Föderales IT-Architekturmanagement, Produktmanagement und Portfoliomanagement für die Schwerpunktthemen.
Zudem soll die nötige Transparenz durch den Zugang zu Detailinformationen geschaffen werden. Im Vortrag wollen wir mit Ihnen zu der Ausgestaltung einer zentralen Informationsplattform des IT-Planungsrats für föderale IT-Standards und Ihren konkreten Informationsbedarfen in den Dialog treten.
Best-Practice-Dialog I. B5
Digitalisierung & Nachhaltigkeit in der Stadt Wien – Wiener Gesundheitsverbund als Vorreiter
Die Bedeutung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit nimmt auch in öffentlichen Institutionen zu. Nachhaltigkeitsinnovationen durch digitale Transformation („Twin Transformation“) spielen dabei eine zentrale Rolle. So muss der Wiener Gesundheitsverbund den Nachhaltigkeits- und Innovationszielen der Stadt Wien gerecht werden, welche mitunter äußerst ambitioniert sind. Dazu werden unter anderem neue und umfangreiche Akzente im Bereich des nachhaltigen Krankenhausbaus in den nächsten Jahren gesetzt – der Gesundheitsverbund nimmt dabei eine Vorreiterrolle in der Stadt ein. Dabei kommen Kriterien zur Anwendung, die zum Teil über die aktuellen Normen hinausgehen, um auch den Anforderungen kommender Jahrzehnte gerecht zu werden. Digitalisierung und die Integration von digitalen Technologien sind dabei einer jener substanziellen Faktoren einer erfolgreichen Nachhaltigkeitstransformation.
Best-Practice-Dialog I. B6
Prozessautomatisierung mit der RPA-Lösung von UiPath in der öffentlichen Verwaltung: Erfahrungen aus zwei Perspektiven – Freie und Hansestadt Hamburg und Dataport
2021 haben sich die Freie und Hansestadt Hamburg und der IT-Dienstleister Dataport gemeinsam auf den Weg gemacht, die Hamburger Verwaltung mittels Robotic Process Automation (RPA) von repetitiven Aufgaben zu befreien. Zwei Jahre später sind bereits zahlreiche Prozesse mittels RPA automatisiert und die Pipeline für weitere Automatisierungen ist gut gefüllt. Neben einem Überblick über unsere bisherigen RPA-Aktivitäten mit Fokus auf Herausforderungen, geben wir im Rahmen des Vortrags auch einen Einblick in die Organisation unserer Zusammenarbeit (Arbeitsteilung, Prozesse, Übergabepunkte etc.) zwischen IT-Dienstleister und Stadt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Ansätzen zur Wiederverwendbarkeit von Bots und der Skalierung von RPA – auch über Bundeslandgrenzen hinweg. Zudem stellen die Referenten ihre weiteren Ideen und Pläne zur Nutzung von RPA in der Verwaltung vor. Der Vortrag richtet sich an alle, die sich für die Umsetzung von RPA in der öffentlichen Verwaltung interessieren und von den Erfahrungen der Freien und Hansestadt Hamburg und Dataport profitieren möchten.
Zukunftsforum I.IV.2
Deutschland und digitale Identität(en): Kommt der Durchbruch mit der EU-Wallet oder früher?
Die Europäische Kommission führt mit der neuen eIDAS-Verordnung (eIDAS 2.0) die EU Digital Identity Wallet (EUDIW) ein: eine Infrastruktur für digitale „Brieftaschen“, die Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen auch grenzüberschreitend nutzen können.
Deutschland bringt sich über das Projekt Digitale Identitäten intensiv in den eIDAS-Prozess ein. Aufsetzend auf dem sicheren und bewährten eID-System werden in dem Kooperationsprojekt mehrerer Ministerien die Komponenten der eID-Infrastruktur weiterentwickelt – insbesondere im Hinblick auf ihre Skalierbarkeit mit dem Ziel, eine ständige hohe Verfügbarkeit der Infrastruktur zu erreichen. Angestrebt wird eine breite Akzeptanz für eine sichere und datenschutzkonforme und datensparsame Ident-Lösung auf Basis des Online-Ausweises, die von Behörden und Unternehmen genutzt wird, in den EU-Mitgliedstaaten nutzbar ist und mit anderen europäischen Lösungen kompatibel ist.
In Vorbereitung auf eIDAS 2.0 werden in dem europäischen Konsortium „PilOTs for EuropeaN digiTal Identity wALlet (POTENTIAL) sechs Anwendungsfälle für die Erprobung einer EUDIW im grenzübergreifenden Alltag entworfen und getestet, zum Beispiel für digitale Behördengänge, für die Kontoeröffnung oder für die Ausleihe eines Mietwagens. Parallel wird ein Architekturprozess für den Prototypen einer nationalen eIDAS 2.0-konformen Referenz-Wallet aufgesetzt; hierzu läuft von Juni bis November 2023 ein Konsultationsprozess auf der Gitlab-Instanz von Open CoDE. Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft werden einbezogen und gestalten die Weiterentwicklung des deutschen eID-Systems mit.
In dem Zukunftsforum wollen wir diese Vorhaben des Projekts Digitale Identitäten aus staatlicher und privatwirtschaftlicher Perspektive erörtern. Auch die Hürden und Risiken der Vorhaben werden dabei in den Blick genommen.
ZuKo Main Stage I.V - Das besondere Gespräch am Abend
Moderner Staat und Demokratie: Eine Debatte über Reformfähigkeit und die Aufgabenverteilung sowie Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen
Der Föderalismus ist das starke "Organisationsmodell" Deutschlands. Seine Stärke sind die Stärken der vielen Regionen mit ihren regionalen Zentren für diverse Wirtschaftsbranchen wie Finanzen, Häfen, Mode, Kultur etc. und nicht zuletzt daraus resultierend die vielen regionalen "hidden champions", die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Was also nach dem zweiten Weltkrieg durchaus mit dem Ziel einer Schwächung der "Zentrale" von den Westalliierten als Voraussetzung für den staatlichen Neubeginn in Westdeutschland als zentraler Baustein der demokratischen Ordnung ausdrücklich aufgezwungen wurde, hat sich als Glücksfall der Geschichte erwiesen. Zusammen mit dem Subsidiaritätsprinzip, wonach nur, wenn die kleinere staatliche Ebene (die Kommune, das Land) eine Aufgabe nicht mehr bewältigen kann, die übergeordnete (der Bund) hilft, ist der Föderalismus auch ein Garant für die "bürgernahe" Politik und Verwaltung. Aber jedes Organisationsmodell muss auf Veränderungen im Markt, der Gesellschaft oder durch neue Technologien reagieren und an seiner Optimierung arbeiten, damit es wettbewerbsfähig bleibt. Nicht zuletzt die vielen Krisen der vergangenen Jahre oder das schleppende Tempo der Digitalisierung lassen daher die Rufe nach notwendigen Staats- und Föderalismusreformen zuletzt wieder häufiger und lauter erschallen. Das Plenum am Abend greift diese Rufe auf und widmet sich dem Thema aus der Sicht von Praktikerinnen und Praktikern wie folgt:
- Was sind derzeit die Stärken und Schwächen im System? Was lässt sich aus den Schwächen für Reformen ableiten?
- Wie könnte die Zusammenarbeit im Föderalismus auch ohne große Reformen verbessert werden?
- Was sind ggf. mittel- und langfristige Reformnotwendigkeiten und wer müsste sie anstoßen? Wird der "Föderalismusdialog im Koalitionsvertrag der Ampel" schon gelebt und ist er der richtige Impuls?
Zukunftswerkstatt II.III.6
Bürger:innenbeteiligung neu denken - die Kokreative Kommune
Kommunen spielen bei der Bewältigung der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen eine besondere Rolle, denn in Kommunen spielt sich das Leben der Bürger:innen ab. Notwendige Vorhaben müssen nicht nur bei diesen Menschen ankommen, sondern von ihnen akzeptiert und aktiv unterstützt werden. Dafür braucht es gute Beteiligung.
Eine gute Beteiligung zeichnet sich dadurch aus, dass tatsächlich mit allen gemeinsam an konkreten umsetzbaren Lösungen zu gesellschaftlichen Fragestellungen gearbeitet wird und diese aktiv miteinander umgesetzt werden. Diese Form wird kokreative Beteiligung genannt oder einfach Kokreation.
Kokreation liefert einen neuen Ansatz der Bürger:innenbeteiligung, der vor allem für Kommunen neue Türen öffnet, um nachhaltige Zukunftsstrukturen zu formen. Das zu organisieren und zu unterstützen, ist die Aufgabe von Kommunen und gelingt mit Mut, Engagement und der Freude am Gestalten eines guten Lebens vor Ort. Und mit den Fähigkeiten eine gute Beteiligung zu organisieren! Und wie das geht, darüber sprechen wir.
Best-Practice-Dialog II. E6
Die Perspektive jedes einzelnen Verwaltungsmitarbeitenden zählt: Mit Human-Centered-Process-Design die Arbeitgeberattraktivität und Verwaltungseffizienz steigern
Es reicht nicht aus, für 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsleistungen zu digitalisieren, wenn die 5 Millionen Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung in Deutschland nicht in die Gestaltung genau dieser Leistungen miteinbezogen werden. Eine nachhaltige Verwaltungsdigitalisierung braucht die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger deshalb genauso sehr wie die ihrer Beschäftigten.
Wie die konsequente Ausrichtung der Behördenprozesse entlang der Bedürfnisse aller Mitarbeitenden gelingt und dabei die Effizienz und Arbeitgeberattraktivität der öffentlichen Verwaltung gesteigert werden kann, diskutiert Darius Selke (Sopra Steria) gemeinsam mit der norwegischen Service-Design-Expertin Angelica Braccia (EGGS Design), dem Mitglied der Projektgruppe E-Akte im BVA Christian Pütz, und der Service-Designerin Maria Formisano (DRV Bund).
ZUKO Main Stage Plenum am Abend II
1. Public Leadership Award: Das Finale & Sieger*innenehrung
Wer hat das beste Projekt oder Konzept für herausragende Fortschrittskulturen in der Öffentlichen Verwaltung? Entscheiden Sie mit!
Der Public Leadership Award wird erstmalig im Rahmen des 9. Zukunftskongress Staat & Verwaltung unter der Schirmherrschaft des BMI in Zusammenarbeit mit Kienbaum und Wegweiser verliehen werden. Der Award wird herausragende Fortschrittskulturen in der Öffentlichen Verwaltung prämieren und damit weithin sichtbar machen, als Anerkennung und Anreiz für andere.
Mit dem Ziel, Fortschritt zu fördern, Anreize zu schaffen und Personen, Teams und Abteilungen, die Fortschritt bereits jetzt leben, zu ermutigen, gibt es Auszeichnungen in fünf Kategorien der öffentlichen Verwaltung: Bund, Länder, Kommunen, Justiz und Sozialversicherungen. Die Jury aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft hat die Shortlist gewählt, die sich am Abend dem Voting der Teilnehmer*innen des Zukunftskongress stellt. Voten Sie mit und bestimmen Sie, wer den 1. Public Leadership Award bekommen soll.
Zukunftsforum III.I.2
Souveräne Cloud – quo vadis
Souveräne Cloudangebote werden langsam, aber sicher konkret. In den nächsten Monaten und Jahren werden zunehmend Angebote von nationalen wie globalen Hyperscalern nutzbar werden, auch die souveränen Cloudangebote der ÖV werden konkreter. Worin unterscheiden sich die Angebote? Welche Fragen scheinen gelöst und welche sind noch offen? Wo muss das Angebot und Betriebsmodell auf Anbieterseite noch geschärft und entwickelt werden, wo müssen die Verwaltung und ihre IT-Dienstleister noch Hausaufgaben machen? Eine Bestandsaufnahme und ein Ausblick aus verschiedenen Perspektiven.
Best-Practice-Dialog III. C1
WSP.NRW ALS TEMPOMACHER TRANSFORMIERT GRÜNDUNGSPROZESS: Verwaltungsprozesse für Gründer:innen schnell, digital und nutzenorientiert gestalten
Ziel und praktischer Nutzen des OZG-Gründungsprojekts des Wirtschafts-Service-Portal.NRW (WSP.NRW) ist die Neugestaltung der Verwaltungsprozesse für Gründer:innen. Mit solch integrierter Verwaltungsleistung „Gründung“ transformiert das WSP.NRW den Gründungsprozess konsequent hin zu einer No-Stop-Agency: kundenorientiert, transparent und schnell. Diese Transformation löst den bisher komplexen und langwierigen Gründungsprozess ab. Expert:innen dieser Gesprächsrunde erklären und diskutieren, inwieweit hierbei alle Potenziale im Sinne einer Ende-zu-Ende-Digitalisierung gehoben werden können. Praxisnahe Lösungsvorschläge wie beispielsweise das Portal Gründer:innen in NRW zeigen, wie eine Unternehmensgründung bzw. einen Start in die Selbständigkeit ab dem Jahre 2025 innerhalb von bis zu zehn Tagen ermöglicht. Dreh- und Angelpunkt ist bei diesem Projekt das WSP.NRW als zentrales und digitales Tor für Gründer:innen, welches entsprechend des EfA-Prinzips die Mitnutzung perspektivisch auch in ganz Deutschland ermöglicht. Dies ist ein essenzieller Schritt in Richtung unserer Vision: Wir wollen den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, Impulse für die Verwaltungsdigitalisierung setzen und neue Standards etablieren – und das über die Digitalisierung des Front-Ends hinaus. Mit dem Gründungsprojekt pilotieren wir die Umsetzung von Once-Only sowie Ende-zu-Ende und setzen damit Trends für die nächste Generation der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland.
III. ZuKo Breaking News
Vorstellung der Ergebnisse des diesjährigen KI-Hackathons
In den letzten beiden Veranstaltungstagen haben die Entwickler:innen an dem von Ihnen ausgewählten Anwendungsfall des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Das Ergebnis ist ein virtueller Assistent zur formlosen Beantragung von Sozialleistungen. In diesem Slot präsentiert das Team die Ergebnisse durch eine Demonstration und gibt Einblicke in das Vorgehen.
Zukunftsforum III.II.1
Digitalisierung in Deutschland: Innovation braucht eine Reiseleitung
Wo bleiben die großen Erfolge, welche die Digitalisierung des Staates so dringend benötigt? Schadet das Narrativ der „großen Erfolge“ vielleicht sogar, weil Digitalisierung immer Stückwerk ist? Klar ist: trotz immenser Investments und vereinzelter Teilsiege verpufft Digitalisierung in der Breite nach wie vor im gefühlten Nichts.
Das Vorhandensein eines Innovation Labs oder einer Innovationseinheit ist dabei leider kein Erfolgsgarant für Organisationen. Woran also fehlt es? Das Zusammenspiel ist der Schlüssel: es braucht ein Operating Model für Innovation, welches Räume definiert, um mutige Entscheidungen zu treffen, und die Struktur gibt, diese Entscheidungen auch umzusetzen.
Was muss die öffentliche Verwaltung beachten, wenn sie digitale Erfolge feiern will?
Zukunftsforum III.II.4
Selbst-Souveräne Identitäten: Die Zukunft der Identitätsverwaltung bei Behörden
Der Einsatz von Selbst-Souveränen Identitäten (SSI) kann Behördenprozesse deutlich effektivieren. Die Basis hierfür legt das Konzept von SSI, das auch durch Privacy-Enhancing Technologies (PET) den Umgang mit Identitäten neu definiert. Mit SSI wird den Bürgern die Kontrolle über ihre digitalen Identitäten und persönlichen Daten ermöglicht, während Behörden von erhöhter Sicherheit, Datenschutz und Effizienz profitieren.
Wie der Einsatz von Selbst-Souveränen Identitäten in Behördenprozessen gelingt und dabei die Effizienz der öffentlichen Verwaltung gesteigert werden kann, diskutiert Thomas Walsch (Sopra Steria) gemeinsam mit dem Managing Director von Public Deutschland Nils Hoffmann und den Sopra Steria Fachexperten Daniel Träder und Joachim Gretenkord.
ZUKO Main Stage III.III Plenum am Nachmittag (Abschluss)
Ausblick 2024: Wie arbeiten wir besser in Bund, Ländern und Kommunen zusammen und beschleunigen die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung?
Nach 3 arbeitsreichen Tagen fassen wir kurz und prägnant Erkenntnisse und Ergebnisse des 9. Zukunftskongresses Staat & Verwaltung zusammen. Insbesondere stellen wir das Ergebnis unseres KI-Hackathons vor und wir präsentieren Gedanken und Lösungsansätze der Verwaltung der Zukunft von jungen Verwaltungsmitarbeitenden des Barcamp U30. Diese Ergebnisse diskutieren wir im Anschluss mit Expertinnen und Experten.
Plenum - Diskussion der Ergebnisse des Zukunftspanel-Spezial
Nach der Wahl ist vor den großen Reformen? Aufgaben für einen zukunftsfähigen Staat
Der Bruch der Ampelkoalition und die daraus resultierenden vorgezogenen Bundestagswahlen haben deutlich gemacht, dass das Vertrauen großer Teile der Bevölkerung in die Politik – insbesondere aber in die Handlungs- und Leistungsfähigkeit des Staats – gesunken ist. Bereits während des kurzen, aber intensiven Wahlkampf wurden viele politische Themen und Herausforderungen auf die Agenda gesetzt. Ein Bereich, der trotz seiner hohen Relevanz in der öffentlichen Debatte zu kurz kam, war die Staatsmodernisierung und Digitalisierung. Erst mit den Koalitionsverhandlungen erhält dieses zentrale Thema mehr Aufmerksamkeit und spiegelt sich nun entsprechend in den Arbeitsgruppen der beteiligten Parteien für die Koalitionsverhandlungen wider.
Nun liegt es an der neuen Regierung die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um entscheidende Reformen auf den Weg zu bringen und das Vertrauen der Bürger:innen zurückzugewinnen. Doch welche Impulse sind jetzt erforderlich – und vor allem, wie sollten sie umgesetzt werden?
Vor dem Hintergrund der vorgezogenen Bundestagswahlen hat Wegweiser gemeinsam mit Hertie School Centre for Digital Governance das Zukunftspanel-Spezial durchgeführt - eine deutschlandweite Befragung sowohl von Vertreter*innen der Verwaltung sowie aus der Wirtschaft und der Wissenschaft.
Die Studie beleuchtet unter anderem:
die Einschätzung der Parteiprogramme in Bezug auf Themensetzung und Umsetzungskompetenz mit Blick auf Staatsmodernisierung und Digitalisierung
die Bewertung aktueller Reformvorschläge nach Relevanz und Dringlichkeit,
die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung,
den Einsatz von Schlüsseltechnologien zur Modernisierung des Staates.
Die Ergebnisse der Umfrage ermöglichen es zentrale verwaltungspolitische sowie staatliche Impulse für die kommende Regierung abzuleiten, die dabei helfen die oben genannten Fragestellungen zu beantworten.
Eröffnungsplenum I.1
Souverän durch die Zeitenwenden: Wege zwischen Abhängigkeit und Autonomie
Die digitale Welt ist geopolitisches Spannungsfeld. Europa muss digitale Souveränität sichern – ohne sich von globalen Innovationen abzukoppeln.
Im Fokus stehen resiliente Cloud-Infrastrukturen, offene Standards und Open Source als Grundlage eines souveränen „Deutschland-Stacks“. Ziel ist strategische Resilienz statt Abschottung, und faire Wettbewerbsbedingungen im digitalen Raum.
Föderierte Clouds, Edge Computing und Open-Source-Technologien bieten Alternativen zu Plattformmonopolen. Dabei geht es um die Balance zwischen Unabhängigkeit und internationaler Zusammenarbeit.
Diskussionspunkte:
Wie lassen sich digitale Abhängigkeiten reduzieren?
Welche Rolle spielt das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS)?
Können auch internationale Anbieter souveräne Lösungen bieten?
Eröffnungsplenum I.2
Lagebild Cybersicherheit: Digitale Bedrohungslagen in Deutschland
Cybervorfälle betreffen zunehmend zentrale Bereiche von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Angriffe auf kritische Infrastrukturen, Datendiebstahl und Erpressungssoftware sind keine Einzelfälle mehr, sondern Teil einer sich wandelnden Gefährdungslage. In diesem Forum wird aufgezeigt, welche Akteure und Angriffsmuster heute besonders relevant sind – und wie Prävention, Detektion und Reaktion strukturell verbessert werden können.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle souveräner Cloud-Infrastrukturen für eine belastbare IT-Sicherheitsarchitektur. Gefragt sind technische Lösungen, die nicht nur Schutz bieten, sondern auch Kontrolle über Daten und Systeme sichern. Im Fokus stehen außerdem rechtliche Rahmenbedingungen, der Aufbau öffentlicher Schutzkapazitäten und neue Kooperationsmodelle zwischen Verwaltung, Forschung und Industrie.
Diskutiert wird unter anderem:
Welche Bedrohungslagen prägen das aktuelle Cybersicherheitsbild?
Wie tragen souveräne Cloud-Architekturen zur Risikominimierung bei?
Was brauchen öffentliche Einrichtungen und Einrichtungen der Kritischen Infrastruktur, um wirksam geschützt zu sein?
Eröffnungsplenum I.3
Im besonderen Blickwinkel der neuen Legislatur: Staatsmodernisierung und Digitalisierung
Die neue Legislatur bringt einen Paradigmenwechsel: Mit dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung wird erstmals ein klarer politischer Auftrag zur Verwaltungsmodernisierung formuliert. Der Koalitionsvertrag verspricht weniger Bürokratie, digitale Souveränität und eine leistungsfähige, bürgernahe Verwaltung.
Im Impuls skizziert unser Keynote Speaker seine persönliche Erwartung: Er fordert mutige Strukturreformen, klare Prioritäten und echten Umsetzungswillen. Nur wenn der Kulturwandel in Behörden gelingt, digitale Infrastruktur gestärkt und Verwaltung konsequent entlastet wird, kann der Staat wieder handlungsfähig und zukunftsfest werden. Der Impuls ist ein Plädoyer für Tempo, Verbindlichkeit – und den politischen Mut, gewohnte Pfade zu verlassen.
Blickwinkel I.3.1
OpenSource als Werkzeug für Unabhängigkeit
Open Source ist im öffentlichen Sektor längst kein Nischenthema mehr – und gewinnt angesichts geopolitischer Spannungen, digitaler Abhängigkeiten und regulatorischer Anforderungen weiter an Relevanz. Der Zugriff auf offen einsehbaren Quellcode, transparente Entwicklungsprozesse und die Möglichkeit zur gemeinschaftlichen Weiterentwicklung versprechen eine tragfähige Grundlage für souveräne digitale Infrastrukturen.
Doch wie unabhängig macht Open Source tatsächlich? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Open Source-Komponenten sicher, nachhaltig und rechtskonform betrieben werden können – insbesondere in kritischen Bereichen wie der öffentlichen IT? Und wie gelingt die Balance zwischen Eigenverantwortung und externem Support?
Diese Session beleuchtet Open Source aus verschiedenen Perspektiven: Verwaltung, Anbieter, Community. Im Fokus stehen dabei strategische, technische und organisatorische Fragen rund um Souveränität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit.
Diskutiert werden u. a. folgende Fragen:
Welche Rolle spielt Open Source für digitale Souveränität – und wo liegen die Grenzen?
Wie kann der öffentliche Sektor Open-Source-Lösungen strategisch auf- und ausbauen?
Welche Herausforderungen entstehen bei Wartung, Sicherheit und langfristigem Betrieb?
Welche rechtlichen und lizenzrechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden?
Wie gelingt es, durch Open Source innovationsfähig zu bleiben – ohne neue Abhängigkeiten?
Open Source ist kein Allheilmittel – aber ein möglicher Schlüssel für mehr Unabhängigkeit in einer zunehmend konzentrierten digitalen Welt.
Blickwinkel I.3.2
Ein Blick ins Kleingedruckte: Auftragsdatenverarbeitung in souveränen Clouds
Cloud-Lösungen gelten als zentraler Baustein digitaler Souveränität – doch der operative und rechtliche Alltag beginnt dort, wo die Verträge unterschrieben werden. Wer souveräne Cloud-Dienste nutzen will, muss verstehen, was in der Auftragsverarbeitung geregelt werden muss – und wo kritische Fallstricke lauern.
Diese Session beleuchtet die Anforderungen an datenschutzkonforme Vertragsgestaltung nach Art. 28 DSGVO und diskutiert, wie hoheitliche Datenverarbeitung rechtssicher ausgelagert werden kann – ohne Kontrollverlust oder Abhängigkeiten.
Behandelt werden u. a. folgende Themen:
Welche Mindestanforderungen gelten für Auftragsverarbeitungsverträge in souveränen Clouds?
Wie lässt sich die Datenhoheit durch technische und vertragliche Vorkehrungen sichern?
Was bedeutet echte „Souveränität“ im Verhältnis zwischen Auftraggeber und Cloud-Anbieter?
Die Session richtet sich an Fachverantwortliche, die Cloud-Nutzung nicht nur technisch, sondern auch rechtlich und strategisch sicher gestalten wollen.
Blickwinkel I.4.1
Anforderungen an souveräne Cloud Umgebungen unter verschiedenen Blickwinkeln
Was macht eine Cloud souverän – und für wen? Die Anforderungen an souveräne Cloud-Umgebungen unterscheiden sich je nach Perspektive: Verwaltung, IT-Betrieb, Datenschutzaufsicht und Anbieter verfolgen unterschiedliche Schwerpunkte, wenn es um Sicherheit, Transparenz, Datenhoheit und Rechtskonformität geht.
In dieser Session werden technische, organisatorische und rechtliche Anforderungen aus verschiedenen Rollen beleuchtet. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis für tragfähige, souveräne Cloud-Lösungen zu schaffen – mit Blick auf Architektur, Betriebsmodelle, Auditierbarkeit, Zugriffskontrollen und Vertrauenswürdigkeit.
Zur Diskussion stehen u. a.:
Welche Kriterien definieren eine souveräne Cloud aus Sicht der Verwaltung und von Anwendern aus der Kritischen Infrastruktur?
Welche Anforderungen stellt der Datenschutz an Infrastruktur und Betrieb?
Wie können Anbieter und Nutzer langfristige Souveränität absichern?
Blickwinkel I.4.2
Demo Session: Souveräne GPUs und Edge Computing - Autonomie vor Ort
Neben klassischen Cloud-Komponenten gewinnen souveräne GPUs und Roving Edge Devices zunehmend an Bedeutung – sei es bei sicherheitsrelevanten Behörden oder in industriellen Use Cases, wenn keine Möglichkeit zur Verbindung in ein Rechenzentrum besteht. Bevor wir in konkrete Anwendungen eintauchen, werfen wir zunächst einen Blick auf die technologischen Grundlagen und Möglichkeiten, die bereits heute verfügbar sind.
Abschlussplenum I.5
Welt im Wandel - Wie sicher & souverän können Clouds sein?
Im Abschlussplenum werden die Erkenntnisse des Tages gebündelt: Welche Anforderungen müssen souveräne Clouds heute erfüllen? Was haben Praxisbeispiele, rechtliche Perspektiven und technische Einblicke gezeigt? Und welche offenen Fragen bleiben bestehen?
Im Spiegel globaler Spannungen, wachsender Cyberrisiken und neuer Regulierungsvorhaben diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Forschung:
Wie gelingt der Aufbau vertrauenswürdiger Cloud-Infrastrukturen in einer vernetzten Welt?
Wo liegen Chancen – und wo Grenzen – europäischer oder nationaler Cloud-Modelle?
Was bedeutet „digitale Souveränität“ konkret für die Umsetzung in Verwaltung, Öffentlicher IT und Kritischer Infrastruktur?
Das Plenum lädt zum Rückblick, zur kritischen Reflexion und zur gemeinsamen Standortbestimmung ein – mit Blick nach vorn: Wie kann Europas digitaler Weg zugleich sicher, offen und souverän gestaltet werden?
Vorabendevent im kleineren Kreis
Der Sozialstaat vor der Neuordnung? Reformen im steuerfinanzierten System und systemische Folgen
Die neue Bundesregierung plant eine grundlegende Reform des steuerfinanzierten Sozialstaats, deren Eckpunkte bis Ende des Jahres vorgelegt werden sollen. Im Zentrum steht die Frage, wie Leistungen wie das Bürgergeld neu ausgestaltet und gegebenenfalls mit anderen Elementen des Sozialstaats verzahnt werden können. Der Reformprozess zielt nicht nur auf Effizienzgewinne und gerechtere Verteilung, sondern stellt auch die Balance zwischen steuer- und beitragsfinanzierten Leistungen zur Disposition.
Vor diesem Hintergrund geht der Abend der Frage nach, welche Auswirkungen die Reform auf die Belastung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern haben könnte, wie sich die Trennlinien zwischen steuer- und beitragsfinanzierten Leistungen verschieben und welche sozialen Gruppen besonders profitieren oder Nachteile erfahren könnten. Auch die langfristige Finanzierbarkeit des Sozialstaats im Licht demografischer und wirtschaftlicher Veränderungen steht im Fokus.
Das Thema berührt grundlegende Fragen der Systemlogik und Gerechtigkeitsvorstellungen in der sozialen Sicherung: Geht es um punktuelle Justierungen oder um einen Paradigmenwechsel in der Architektur des Sozialstaats? Die Veranstaltung soll Raum geben für eine fundierte Debatte über Ziele, Wirkungen und Optionen einer Reform, die weit über das Bürgergeld hinausweist.
Eröffnungsplenum I.I
Sozialstaat der (nahen) Zukunft – digital, kundenorientiert, aktivierend und gerecht?
Das deutsche Sozialversicherungssystem steht vor der Aufgabe einer grundlegenden Erneuerung: Über 140 Jahre bewährte Strukturen treffen heute auf digitale Disruption, demografischen Wandel und wachsende gesellschaftliche Erwartungen. Der Koalitionsvertrag 2025 formuliert dazu einen klaren Anspruch: Der Sozialstaat muss digitaler, leistungsfähiger, gerechter und wirtschaftlich tragfähig gestaltet werden.
Im Eröffnungsplenum des 4. Zukunftskongresses Sozialversicherungen wird diskutiert, wie diese sozialstaatliche Transformation gelingen kann – konkret, praktikabel und mit Blick auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Realität. Im Fokus stehen zentrale Leitlinien aus dem Koalitionsvertrag:
Digitalisierung & Nutzerzentrierung: Einführung digitaler Identitäten, medienbruchfreie Antragsverfahren, „Once Only“-Prinzip und Plattformlösungen für Sozialleistungen.
Effizienz & Transparenz: Bündelung von Leistungen, vereinfachte Verwaltungsverfahren, durchgängige digitale Prozessketten und Entbürokratisierung.
Generationengerechtigkeit & stabile Finanzierung: Rentenstabilisierung, Frühstart-Rente, strukturelle Reformen in der gesetzlichen Sicherung – mit Blick auf eine faire Verteilung der Lasten zwischen den Generationen.
Wirtschaftliche Nachhaltigkeit & Standortfaktor Sozialkosten: Die Finanzierung des Sozialstaats muss so gestaltet werden, dass sie langfristig planbar bleibt – auch für Unternehmen. Die Sozialkosten dürfen kein Wettbewerbsnachteil sein, sondern müssen durch effiziente Strukturen, Digitalisierung und Verlässlichkeit tragfähig gestaltet werden.
Forum I.II.1
Von Inseln zu Ökosystemen – IT-Architekturen, Shared Services und der Weg zur vernetzten Sozialverwaltung
Viele Digitalisierungsvorhaben in der Sozialverwaltung entstehen als Insellösungen: funktional stark, aber oft nur begrenzt anschlussfähig. Der Koalitionsvertrag 2025 betont die Notwendigkeit gemeinsamer technischer Grundlagen, interoperabler IT-Architekturen und koordinierter Digitalstrategien – mit dem Ziel, Synergien zu schaffen und Ressourcen intelligenter zu nutzen.
Diese Session nimmt die strukturelle Perspektive in ihr Visier: Wie lässt sich aus technischer Fragmentierung ein verlässliches, lernfähiges Digital-Ökosystem entwickeln? Was sind zentrale Gelingensbedingungen für Shared Services, standardisierte Schnittstellen und tragfähige Governance-Strukturen zwischen Trägern und Ebenen?
Fachleute aus Praxis, IT, Verwaltung und Strategie diskutieren, wie technologische Plattformen zu echten Brücken werden – und wie der Kulturwandel zwischen Institutionen gelingen kann.
Forum I.II.2
Mensch & Maschine – KI, Effizienz und die digitalen Kompetenzen der Zukunft
Künstliche Intelligenz verändert Prozesse, Entscheidungswege und Rollenbilder – auch in der Sozialversicherung. Automatisierte Fallbearbeitung, intelligente Vorprüfung oder KI-gestützte Kommunikation versprechen Effizienzgewinne, werfen aber auch neue Fragen auf: Welche Kompetenzen brauchen Mitarbeitende, wenn Maschinen mitentscheiden? Und wie kann die Organisation dafür sorgen, dass Technologie den Menschen unterstützt – nicht ersetzt?
In dieser Session geht es um den Wandel der Arbeit im Zeichen von KI:
Wie verändert sich das Berufsbild in der Sozialverwaltung?
Welche digitalen Fähigkeiten werden zur Schlüsselkompetenz?
Wie gelingt Qualifizierung bei laufendem Betrieb – und mit Akzeptanz?
Praxisbeispiele, strategische Perspektiven und Erfahrungsberichte zeigen, wie Mensch und Maschine sinnvoll zusammenwirken können – für ein leistungsfähiges, aber zugleich menschliches System sozialer Sicherheit.
Werkstatt I.II.3
Mut zum Vergleich – Was öffentliche und private Versicherungen in der Modernisierung der Kernsysteme voneinander lernen können
Was läuft anders – und was vielleicht besser?
Die Sozialversicherung operiert unter anderen Rahmenbedingungen als private Anbieter. Doch genau deshalb lohnt der Blick über den eigenen Tellerrand. Diese Session bringt Verantwortliche aus Sozialversicherungsträgern und privaten Versicherungsunternehmen zusammen – nicht zum Wettbewerb, sondern zum Austausch.
Im Fokus stehen konkrete Fragen wie:
Wie lassen sich Prozesse verschlanken und digitale Services beschleunigen?
Wie messen beide Seiten Effizienz, Servicequalität und Kundenzufriedenheit?
Welche Lessons Learned aus der Privatwirtschaft sind übertragbar – und welche bewusst nicht?
Wo kann der öffentliche Sektor Vorbild für Fairness, Solidität und Vertrauen sein?
Das Format schafft Raum für offenen, ehrlichen Dialog – jenseits ideologischer Schranken. Denn nur wer vergleicht, erkennt, wo noch Potenziale liegen.
Best-Practice-Dialog I.B.1
Zwischen Klick und Kontakt – Digitalisierung mit persönlicher Note
Die Digitalisierung verändert die Erwartungen an Serviceangebote – auch in der Sozialversicherung. Doch nicht alle digitalen Self-Service-Angebote funktionieren zuverlässig oder werden von allen Zielgruppen gleichermaßen angenommen. Wie kann eine Institution, die alle Menschen mitnehmen muss, digitale Services effizient gestalten und gleichzeitig die Stärke persönlicher Interaktion bewahren?
Am Beispiel der AOK Niedersachsen wird gezeigt, wie eine gesetzliche Krankenkasse diesen Spagat erfolgreich meistert – mit einem Ansatz, der digitale Effizienz und menschliche Nähe verbindet.
Best-Practice-Dialog I.D.1
System im Umbruch: Wie Sozialversicherungsträger dem doppelten demografischen Wandel strategisch begegnen
Die Sozialversicherung steht vor einer doppelten demografischen Herausforderung: Während insbesondere in der Renten- und Krankenversicherung die Zahl der Leistungsempfänger kontinuierlich steigt, verlieren die Träger selbst zunehmend erfahrenes Personal – insbesondere durch den Ruhestand der Babyboomer-Generation. Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung geraten dadurch finanziell, organisatorisch und technologisch unter Druck. Der Best-Practice-Dialog zeigt, wie Träger mit strategischer Steuerungsfähigkeit, digitaler Resilienz und sektorübergreifender Kooperation diesen Wandel aktiv gestalten und die Zukunft der sozialen Sicherung sichern können.
Kommen Sie zum Best-Practice-Dialog, wenn Sie konkrete Ansätze und Impulse suchen, wie Sie dem doppelten demografischen Wandel wirksam begegnen können.
Forum I.III.1
Vom Antrag zur Automatik – Wie Staatsmodernisierung und Sozialversicherung gemeinsam digital wachsen
Die Sozialversicherung ist ein zentrales Anwendungsfeld für die digitale Transformation des Staatswesens. Der Koalitionsvertrag 2025 formuliert eine klare Vision: Mit der Deutschland-ID, dem Once-Only-Prinzip und der antragslosen Leistungserbringung soll eine neue Ära bürgerzentrierter, digitaler Verwaltung eingeläutet werden.
Im Zentrum stehen medienbruchfreie, lebenslagenorientierte Prozesse, gestützt durch vernetzte Register, sichere digitale Identitäten und gemeinsame Plattformlösungen. Die Sozialversicherung bietet hierfür enormes Potenzial – vom digitalen Rentenbescheid über Reha-Services bis hin zur automatisierten Beitragsabstimmung.
Doch wie lassen sich diese Prinzipien im Geflecht föderaler IT-Strukturen, komplexer Fachgesetzgebung und geteilter politischer Zuständigkeiten tatsächlich umsetzen?
Die Session fragt: Was braucht es, damit die Sozialversicherung zum Vorreiter der Staatsmodernisierung wird?
Werkstatt I.III.2
*Session mit Schwerpunkt Krankenversicherungen*
Wie sieht digitale Sozialversicherung konkret aus – jenseits von Strategiepapieren? In dieser Werkstatt stehen reale Anwendungsfälle im Mittelpunkt: von Plattformen über Cloudlösungen bis zur KI-gestützten Vorgangsbearbeitung.
Fachleute aus Trägern, IT und Umsetzungspraxis präsentieren Use-Cases, die bereits heute im Einsatz sind oder als Prototypen entwickelt wurden. Diskutiert werden technische Voraussetzungen, organisatorische Erfahrungen und rechtliche Rahmenbedingungen – aber auch Herausforderungen auf dem Weg von der Pilotphase zur Regelanwendung.
Ziel ist es, praxisnah zu zeigen, wo Digitalisierung in der Sozialversicherung bereits wirkt – und was es braucht, damit gute Ansätze skalierbar werden.
Themen & Beispiele:
Plattformen mit nutzerzentrierter Ausgestaltung
Cloud und neue Betriebskonzepte
KI bei der Vorprüfung und Entscheidungsunterstützung
...
Werkstatt I.III.3
Sozialdatenschutz im Wandel – zwischen Vertrauensschutz und Datennutzung
Der Koalitionsvertrag 2025 markiert einen Kurswechsel im Umgang mit Sozialdaten: Verwaltungsdaten sollen besser verknüpft, Leistungen vereinfacht und antragslos bereitgestellt werden – unter Wahrung der Grundrechte und bei gleichzeitiger Weiterentwicklung des Datenschutzes. Ziel ist ein moderner, nutzerzentrierter Sozialstaat mit hoher digitaler Reife.
In der Werkstatt wird diskutiert, wie innovative Datennutzung, rechtliche Anforderungen und technische Lösungen praxisgerecht zusammengebracht werden können. Im Mittelpunkt stehen konkrete Ansätze für eine datenschutzkonforme und zukunftsfähige Sozialverwaltung – zwischen Effizienz, Vertrauen und digitaler Verantwortung.
PLENUM AM SPÄTEN NACHMITTAG UND AUSBLICK I.IV
Verstehen. Vertrauen. Verändern. – Politik trifft Praxis zur Zukunft der Sozialversicherung
Wenn politische Ambitionen auf praktische Umsetzung treffen, entsteht oft Reibung – aber auch Fortschritt. In diesem Abendgespräch kommen Reformverantwortliche aus der Politik mit Modernisierer:innen aus der Sozialversicherung ins direkte Gespräch. Im Fokus steht der gemeinsame Blick nach vorn: Wie lässt sich das Sozialversicherungssystem zukunftsfähig, bürgernah und tragfähig weiterentwickeln?
Diskutiert werden Fragen wie:
Was braucht die Praxis, um Innovation in der Fläche zu ermöglichen?
Wo kann Politik durch Rahmensetzung und Entbürokratisierung stärken?
Wie gelingt gegenseitiges Verständnis – jenseits von Paragrafen und Zuständigkeiten?
Das Format bietet Raum für offenen, ehrlichen Austausch, für den Perspektivwechsel zwischen gesetzgeberischer Idee und praktischer Realität – und nicht zuletzt für gemeinsame Lösungsansätze.
Ziel des Abends: Brücken bauen – zwischen Strategie und Struktur, Erwartung und Machbarkeit, Anspruch und Alltag.
Ausklang & Netzwerken
Plenum am Morgen II.I
*angefragt